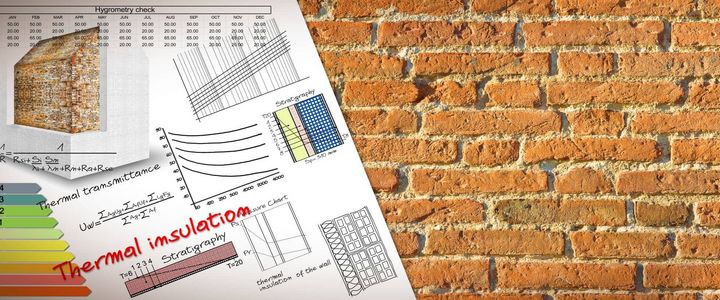Die jüngste Novelle des Gebäudeenergiegesetzes
Schon lange hat kein Gesetz mehr für so viel Aufregung gesorgt wie die jüngste Novelle des Gebäudeenergiegesetzes. Erst nach langen und hitzigen Debatten wurde das „Heizungsgesetz“ im Sommer 2023 verabschiedet.
Die endgültige Fassung unterscheidet sich deutlich vom ersten Entwurf. Trotzdem kommen ab 2024 nicht nur auf viele Privathaushalte größere Änderungen zu. Wir haben uns mit Dr. Henning Hahn darüber unterhalten, warum Unternehmen am besten früh handeln und langfristig denken sollten.
Die Ziele des GEG von 2023 - mehr Energieeffizienz und Unabhänigkeit
Dass die deutsche Regierung die Anforderungen an die Heiz- und Klimatechnik verschärfte, kommt nicht überraschend. Schließlich sieht die EU-Gebäuderichtlinie vor, den Gebäudesektor in der EU bis 2050 klimaneutral zu machen. Deutschland will es sogar fünf Jahre früher, 2045, schaffen.
Für Dr. Henning Hahn ist die angestrebte Klimaneutralität aber nicht der einzige Grund, warum es sinnvoll ist, den Energieverbrauch von Gebäuden stark zu reduzieren und beim Heizen auf erneuerbare Energien umzustellen. Angesichts der Endlichkeit fossiler Energien und der Auswirkungen globaler Krisen werde Versorgungsunabhängigkeit immer wichtiger. Das GEG kann dazu beitragen, Unternehmen ein Stück weit unabhängiger zu machen.
Drei zentrale Änderungen des Gebäudeenergiegesetzes - Zusammenfassung
Die endgültige Fassung des neuen Gebäudeenergiegesetzes enthält viele Details, die eine längere Auseinandersetzung erfordern würden. Deshalb greifen wir zentrale Inhalte heraus.
1. Heizungen müssen mehrheitlich mit erneuerbaren Energien betrieben werden
Neu eingebaute Heizungen müssen in Zukunft zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Allerdings gilt diese Regelung zunächst ausschließlich in Neubaugebieten und für andere Neubauten frühestens 2026, wenn eine kommunale Wärmeplanung vorliegt. In Bestandsgebäuden gibt es eine Übergangsfrist. Während dieser Frist können Eigentümer:innen überlegen, ob sie eine Heizung installieren lassen, die auf überwiegend erneuerbaren Energien basiert, oder ihr Gebäude an ein Fernwärmenetz anschließen lassen.
Eine weitere Ausnahmeregelung gibt es für Hallen mit einer Raumhöhe von mehr als 4 Metern: Hier kann der Tausch von einzelnen dezentralen Geräten wie Infrarotstrahlern oder Warmluftheizungen über einen Zeitraum von 10 Jahren ab dem ersten Tausch erfolgen. Außerdem darf ein fossiles Heizsystem bei einer nachgewiesenen Energieeinsparung von 40 % bis Ende 2044 weiterbetrieben werden.
„Das viel diskutierte Betriebsverbot für Heizkessel auf Basis fossiler Energien ist gestrichen worden“, betont Dr. Henning Hahn. „Nur Standardkessel ohne Außentemperaturregler müssen nach 30 Jahren außer Betrieb genommen werden.“
Eine klare zeitliche Begrenzung gibt es dennoch: Heizkessel dürfen nur bis zum Jahr 2044 mit fossilen Brennstoffen betrieben werden.
Wichtig ist: Das GEG 2023 schreibt beim Einbau einer neuen Heizung eine Beratung vor. Diese soll Gebäudebetreiber:innen die Folgekosten für die nächsten Jahre aufzeigen. Die Hoffnung dahinter ist, dass eine solche Beratung teuren Fehlentscheidungen vorbeugt.
2. Eine Gebäudeautomation wird Pflicht in vielen Gewerbegebäuden
Eine wesentliche Neuerung des GEG 2023 betrifft nur Nichtwohngebäude mit einer Heizungs-, Klima- oder Lüftungsanlage, deren Leistung mindestens 290 kW beträgt. Dabei handelt es sich in der Regel um Gebäude mit über 3.000 Quadratmetern, bei gut gedämmten, modernen Immobilien können es sogar 10.000 oder 12.000 sein.
Werden die 290 kW erreicht, muss die Heizung bis Ende 2024 in eine Gebäudeautomation inklusive digitaler Energieüberwachung integriert werden.
Wie teuer eine Nachrüstung mit einer Gebäudeautomatisierung ist, hängt laut Dr. Henning Hahn von vielen Faktoren ab. „Die Kosten können schnell mehrere 10.000 Euro betragen, amortisieren sich aber meist durch Einspareffekte in einer überschaubaren Zeit.“ Reduzieren lassen sie sich, indem Unternehmen Förderungen in Form von Investitionszuschüssen in Anspruch nehmen.
Ein positiver Effekt von einer Gebäudeautomation abseits von Energieeinsparungen besteht darin, dass diese den Komfort und die Arbeitsbedingungen verbessern kann.
3. Die kommunale Wärmeplanung soll eine zentrale Rolle spielen
Gebäude, die sich laut Planung in einem Nahwärmenetz befinden, müssen an dieses angeschlossen werden. Gelingt dies nicht, obwohl es die Planung vorsieht, muss die Kommune dadurch entstandene Mehrkosten bezahlen.
Für Unternehmen ist diese Regelung vorteilhaft. Schließlich haben sie so mehr Bedenkzeit und profitieren vielleicht von einem Anschluss an ein Nahwärmenetz.
Wir geben Ihnen einen Einblick in die erfolgreiche Implementierung eines Energiemanagementssystems nach DIN EN ISO 5001 und bereiten Sie darauf vor, die Anforderungen in Ihrem Unternehmen ereffektiv umzusetzen.
Unternehmen brauchen eine langfristige Strategie
Dr. Henning Hahn beobachtet, dass Unternehmen unterschiedlich gut auf die Anforderungen des GEG vorbereitet sind. „Größere Unternehmen mit einem Energiemanagementsystem nach ISO 50001 haben das Ziel Klimaneutralität meist schon länger auf der Agenda stehen.“ In ihren Gebäuden sei auch oft schon eine Gebäudeautomation vorhanden.
Kleineren Unternehmen rät er, sich professionell beraten zu lassen und ein strategisches Konzept für den Weg hin zur Klimaneutralität zu erstellen. Dabei seien zahlreiche Faktoren zu beachten. „Die Heizung selbst ist nur die CO2-Schleuder, die durch viele externe Faktoren, angefangen bei der Dämmung von Gebäuden, beeinflusst wird.“ Idealerweise schließe die Beratung das Thema Fördermöglichkeiten ein.
Eine Herausforderung stelle die Realisierung von Umbauten dar. „Ein Flaschenhals ist oft nicht die Intention der Akteure, sondern die Verfügbarkeit und Qualifikation von Fachbetrieben.“ Auch seien die Anforderungen an das Zusammenspiel verschiedener Akteure hoch. „Wenn Sie früher Ihre Heizung tauschen wollten, haben Sie den örtlichen Fachbetrieb aufgesucht. Heute ist der Vorgang viel komplexer.“
Intelligent umrüsten lohnt sich
Wie geglückt das neue Gebäudeenergiegesetz in seiner endgültigen Version ist, ist umstritten. Fest steht: Für Unternehmen, die das Thema Heizen bisher vernachlässigt haben, lohnt es sich in mehrerlei Hinsicht, das Gesetz zum Anstoß für Optimierungen zu nehmen: Abgesehen davon, dass allen, die die Anforderungen des Gesetzes nicht rechtzeitig erfüllen, ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro droht, können Unternehmen durch den Umstieg auf moderne Heizungen und Gebäudeautomationssysteme langfristig viel Geld sparen.
Schließlich sorgen sie auf diese Art für zukünftige, noch strengere Anforderungen an die Energieeffizienz vor. Dass diese kommen, ist angesichts des fortschreitenden Klimawandels sowie der immer näher rückenden energie- und klimapolitischen Zielen der EU mehr als wahrscheinlich.
Ihre Ansprechpartnerin

Produktmanagerin Energie
Am TÜV 1, 30519 Hannover
Tel.: +49 511 998627-75
Fax: +49 511 998620-75
fwestenberger@tuev-nord.de